
🗞 40/2024
LMU-Studie: Riesenfortschritt in der Brustkrebsbehandlung · Zu viele Gesunde beim Arzt? · "Würdezentrierte Therapie" am RBK Stuttgart · Pflanzendrinks oder Kuhmilch? · GMin Lauterbach bringt Präventionsinstitut an den Start
📌 5 weekly picks
1 📌 LMU-Studie: Riesenfortschritt in der Brustkrebsbehandlung
Patientinnen mit sogenanntem fortgeschrittenem HER2-positiven Brustkrebs bekommen sehr häufig Tochtergeschwulste im Gehirn. Dann sind ihre Chancen auf jahrelanges Überleben sehr gering, denn die bisherigen Therapien – Operation und Bestrahlung – helfen nur kurzzeitig. Nun hat ein internationales Team von Forschenden unter Co-Federführung von MINQ-Spezialistin Professor Dr. Nadia Harbeck, Leiterin des Brustkrebszentrums des LMU Klinikums, ein neues Medikament in einer klinischen Studie getestet. „Mit ganz fantastischen Ergebnissen“, wie die Krebsärztin sagt. Die Überlebenszeit verlängert sich nach bisherigen Erkenntnissen deutlich. Die Studienergebnisse wurden im renommierten Fachjournal „Nature Medicine“ veröffentlicht.
Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs und dem Gewebemerkmal HER2 leiden zu 50 Prozent an Tochtergeschwulsten (Metastasen) im Gehirn, die mit Medikamenten bislang nicht behandelbar sind. Denn die Blut-Hirn-Schranke verhindert oft, dass Wirkstoffe in das Denk- und Gefühlsorgan eindringen können. Neue Medikamente sind also dringend gefragt. Einer dieser Wirkstoffe ist ein sogenanntes Antikörper-Konjugat namens „Trastuzumab Deruxtecan“. Trastuzumab ist ein Antikörper, der, einmal in den Körper gespritzt, zielgenau am HER2-Protein andockt. Im Gepäck hat er den Wirkstoff Deruxtecan, der Krebszellen tötet und nur im Tumorgewebe aktiv ist - und kaum im restlichen Körper. „Aus diesem Grund können wir diesen Wirkstoff überhaupt verwenden“, erklärt Harbeck, „sonst wäre er viel zu giftig.“
Um den Nutzen des Antikörper-Konjugats bei HER2-positivem Brustkrebs zu ermitteln, startete die Münchner Medizinerin als eine der beiden Leiterinnen die „DESTINY-Breast12-Studie“. Teilgenommen haben über 500 Patientinnen mit und ohne Hirnmetastasen aus 78 Krebszentren in Westeuropa, Japan, Australien und den USA. Das Medikament ist bereits für den Einsatz in der Regelversorgung zugelassen.
Trastuzumab deruxtecan in HER2-positive advanced breast cancer with or without brain metastases: a phase 3b/4 trial
Harbeck, N., Ciruelos, E., Jerusalem, G. et al. Trastuzumab deruxtecan in HER2-positive advanced breast cancer with or without brain metastases: a phase 3b/4 trial. Nat Med (2024).
https://doi.org/10.1038/s41591-024-03261-7
Weitere Infos zur Studie auf den Seiten der LMU München
2📌 Gehen zu viele Gesunde zum Arzt? Eine Meldung aus der Schweiz
Eine kuriose Feststellung konnten wir dem Schweizer Onlineportal 20min.ch entnehmen: “Ärzte müssen immer mehr jungen Menschen ihre Gesundheit beweisen”. Zitiert werden Experten wie Thomas Harnischberg, Chef der Krankenkasse KPT und Felix Schneuwly vom Krankenversicherungs-Vergleichsportal Comparis: Harnischberg stellte demnach fest, dass zunehmend junge Menschen medizinische Leistungen beanspruchen, oft ohne akute Beschwerden. Schneuwly betonte, dass gerade junge Patienten mit diffusen Symptomen vermehrt zum Arzt gehen – um sich bestätigen zu lassen, dass sie gesund sind.
«Der Anspruch ist heute, dass der Arzt beweisen muss, dass der Patient gesund ist»
Felix Schneuwly, Comparis
Das Phänomen, dass gesunde Personen zum Arzt gehen, wird mit als ein Grund für steigende Kosten der Krankenversicherungen angeführt.
Die steigende Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen durch Gesunde stellt eine grosse Belastung für das Gesundheitssystem dar. Hausarztpraxen sind zunehmend überlastet, und viele Ärzte haben bereits einen Aufnahmestopp verhängt. Sollte dieser Trend anhalten, wird sich die Lage in den kommenden Jahren wohl weiter verschärfen.
Quelle 20min.ch
Offenbar löst die Überfülle an Gesundheits- und Krankheitsinformationen eine zunehmende Verunsicherung bei insbesondere jüngeren Menschen aus. Monika Reber, Co-Präsidentin der Haus- und Kinderärzte, bestätigt in dem Beitrag die Verunsicherung. Früher hätten Ratschläge von Eltern oder Grosseltern oft ausgereicht, heute sei das Vertrauen in medizinische Diagnosen und Apps grösser. Gleichzeitig aber könnten die Informationen aus den sozialen und Onlinemedien oft nicht sachgerecht eingeordnet werden.
Der Zugang zu Informationen hat stark zugenommen, doch viele Menschen tun sich schwer, diese richtig zu interpretieren. Bereits kleinere Veränderungen im Körper lösen Ängste aus, die zu Arztbesuchen führen. Dies erhöht den Druck auf das Gesundheitssystem, das bereits an vielen Stellen überlastet ist.
Quelle 20min.ch
3 📌 Ausgezeichnet: "Würdezentrierte Therapie" am RBK Stuttgart
Die Würdezentrierte Therapie wurde in Kanada von Professor Dr. Harvey Max Chochinov von der University of Manitoba, entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, sich mit ihrem nahenden Versterben auseinanderzusetzen.
In einem 30- bis 60-minütigen Gespräch stellt die Therapeut:in eine Reihe offener Fragen, die die Patient:innen anregen sollen, über ihr Leben oder darüber zu sprechen, was ihnen besonders wichtig ist. Das Gespräch wird aufgenommen, transkribiert und zu einem vorläufigen Dokument aufbereitet, das die Patientin/der Patient nach ein paar Tagen zurückerhält, um es gemeinsam zu lesen, durchzusprechen und mögliche Korrekturen anzubringen, bevor dann die Endversion erstellt wird. Zu Beginn des Gesprächs wird festgelegt, für wen das Dokument erstellt wird. Viele teilen den Wunsch, Angehörigen und Freunden ihre Gedanken und Erinnerungen zu hinterlassen. Quelle: patientenwuerde.de
Das Stuttgarter Robert Bosch Krankenhaus hat nach eigenen Angaben als erstes Krankenhaus in Deutschland die Würdezentrierte Therapie in der Palliativmedizin eingeführt. Bereits seit 2013 bieten ausgebildete Therapeutinnen Menschen, die unheilbar erkrankt sind und sich in einer hochpalliativen Phase befinden, die Möglichkeit, ihr gedankliches Vermächtnis zu formulieren. „Sich am Lebensende zurückbesinnen auf das, was einen im Leben ausgemacht hat, was gelungen ist, was nicht vergessen werden sollte, ist für Betroffene strukturierend und heilsam zugleich“, sagt Simone Kotterik, Leitende Psychologin im Robert Bosch Krankenhaus. „Menschen, die an der Würdezentrierten Therapie teilgenommen haben, äußern tiefe Dankbarkeit für das Gespräch und das Dokument, welches sie für ihre Angehörigen und sich selbst als großes Geschenk erleben.“
Das Robert Bosch Krankenhaus (RBK) wurde nun von der Initiative Patientendialog mit seiner Würdezentrierten Therapie auf den Palliativstationen mit dem „Award Patientendialog 2024“ ausgezeichnet.
Fragenkatalog zur Würdezentrierten Therapie
- Erzählen Sie mir ein wenig aus Ihrer Lebensgeschichte; insbesondere über die Zeiten, die Sie am besten in Erinnerung haben oder die für Sie am wichtigsten sind.
- Wann haben Sie sich besonders lebendig gefühlt?
- Was sind die wichtigsten Aufgabenbereiche, die Sie in Ihrem Leben eingenommen haben (Rollen in der Familie, im Beruf, im Sozialleben etc.)?
- Warum waren Ihnen diese Aufgaben wichtig und was haben Sie Ihrer Meinung nach darin erreicht?
- Was sind Ihre wichtigsten Leistungen, worauf sind Sie besonders stolz?
- Gibt es etwas, von dem Sie merken, dass es gegenüber Ihren Lieben noch ausgesprochen werden will?
- Oder etwas, das Sie gern noch einmal sagen möchten?
- Was sind Ihre Hoffnungen und Wünsche für die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen?
- Was haben Sie über das Leben gelernt, das Sie gern an andere weitergeben möchten?
- Welchen Rat oder welche Worte, die Ihre/n … (Tochter, Sohn, Ehemann, Ehefrau, Eltern, anderen Menschen) leiten können, würden Sie gerne weitergeben?
- Gibt es konkrete Empfehlungen, die Sie Ihrer Familie mitgeben möchten, um sie für die Zukunft vorzubereiten?
- Gibt es speziell für dieses Dokument noch etwas, das Sie hier mit aufnehmen wollen?
Quelle: patientenwuerde.de
Deutsche Gesellschaft für Patientenwürde e. V.
4 📌 Pflanzendrinks oder Kuhmilch? Aktuelle Empfehlungen der DGE
Immer mehr Menschen greifen zu pflanzlichen Milchalternativen. Und die Auswahl an Pflanzendrinks aus Soja, Hafer, Mandeln, Reis und Co. ist in den vergangenen Jahren immer mehr gewachsen. Doch wie gut sind diese Produkte hinsichtlich Gesundheit und Nachhaltigkeit? In einem neuen Positionspapier vergleicht die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) nun Pflanzendrinks mit Kuhmilch und gibt konkrete Empfehlungen.
Für Menschen, die weniger oder keine Milchprodukte zu sich nehmen können oder wollen, können pflanzliche Alternativen sinnvoll sein. Neben Tierwohlaspekten spricht die geringere Umweltbelastung für den Verzehr. Im Vergleich zu Kuhmilch sind die durchschnittlichen Werte für Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Landnutzung niedriger. Ein weiterer positiver Aspekt: Milchalternativen helfen auch dabei, eine pflanzenbetonte Ernährung im Alltag umzusetzen.
Die Nährstoffzusammensetzungen von pflanzlichen Milchalternativen sind allerdings je nach Produkt unterschiedlich. Ohne Nährstoffanreicherung sind sie nicht ohne weiteres mit Kuhmilch vergleichbar:
Unterschiede Planzendrinks vs. Kuhmilch
- Pflanzendrinks liefern in der Regel weniger gesättigte Fettsäuren und kein Cholesterol.
- Milchalternativen aus Samen und Nüssen enthalten mehr ungesättigte Fettsäuren.
- Der Proteingehalt ist mit Ausnahme von Sojaerzeugnissen geringer.
- In Pflanzendrinks aus Getreide wie Hafer oder Reis sind mehr Kohlenhydrate enthalten.
- Je nach Rohstoff kommen gesundheitsfördernde Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe wie Phenole hinzu, die in Milch nicht enthalten sind.
- Manche Inhaltsstoffe wie Phytate können allerdings die Bioverfügbarkeit von Nährstoffen einschränken, also die, die der Körper tatsächlich verwerten kann.
Da Kuhmilch und Milchprodukte wie Joghurt und Käse wichtige Nährstoffe wie Kalzium, Jod, Vitamin B2 und Vitamin B12 liefern, empfiehlt die DGE, täglich zwei Portionen Milchprodukte zu verzehren, was zum Beispiel einem Glas Milch und einer Scheibe Käse entspricht. Wer wenig oder keine Kuhmilch verzehrt, sollte über andere Lebensmittel oder eine Nahrungsergänzung eine ausreichende Versorgung mit Kalzium und Jod sowie bei einer veganen oder vegetarischen Ernährungsweise mit Vitamin B2 und Vitamin B12 sichern. Ansonsten können Nährstoffdefizite die Folge sein, warnt die DGE.
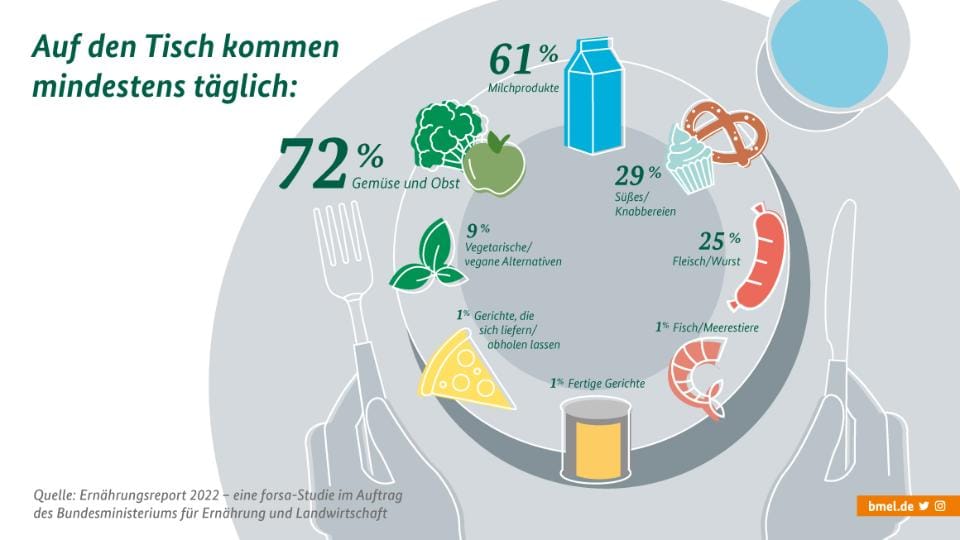
5📌 Präventionsinstitut soll Lebenserwartung in Deutschland verlängern
Mit dem geplanten neuen “Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin”, kurz: BIPAM, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Großes vor. Auf die selbst gestellte Frage: “Welches Problem soll gelöst werden durch eine neue Bundesbehörde?” gibt der Minister bei der Vorstellung des Gesetzentwurfes am 25. September im Bundestag die Antwort:
“Nun, um es kurz zu machen: Der Grund ist, dass die Lebenserwartung bei uns niedriger ist als in fast allen anderen Ländern in Westeuropa. Wir haben die zweitniedrigste Lebenserwartung in Westeuropa bei Frauen und die niedrigste bei Männern, und der Unterschied zu den Ländern an der Spitze wird größer. Wir haben darüber hinaus auch das Problem, dass die Lebenserwartungsunterschiede zwischen Arm und Reich bei uns besonders ausgeprägt sind.” Karl Lauterbach 25.09.2024
Mit der neuen Bundesbehörde soll deshalb nach den Vorstellungen des Ministers die Lebenserwartung in Deutschland durch bessere Vorbeugemedizin verbessern werden.
“Wir verlieren bei der Lebenserwartung im Wesentlichen durch drei Krankheitsgruppen. Wir könnten unter optimalen Bedingungen 40 Prozent der Krebserkrankungen durch Vorbeugung verhindern, wir könnten idealerweise über 80 Prozent der schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Todesfolge verhindern, und wir könnten 20 Prozent, vielleicht sogar 30 Prozent der Demenzerkrankungen verhindern. Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz sind die drei apokalyptischen Reiter der Gesundheit in unserer Bevölkerung. Wir müssen diesen apokalyptischen Reitern der Gesundheit in Deutschland endlich etwas entgegenstellen. Das neue BIPAM wird die Einrichtung sein, die es uns ermöglichen wird, den wichtigsten vorzeitigen Todesursachen in Deutschland wirkungsvoll entgegenzutreten.” Karl Lauterbach 25.09.2024
Zum Gesetzentwurf "Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Öffentlichen Gesundheit"
💬 Über den Tellerrand
1️⃣ Abhängig vom Ausland: Schweiz schafft den Numerus clausus ab
Die Schweiz ist bei der Ausbildung des medizinischen Nachwuchses sehr vom Ausland abhängig. Aber kann die Abschaffung des NCs dies ändern? Der Ständerat, die Vertretung der Kantone in der Schweiz, stimmte mit 32 zu 9 Stimmen einem entsprechenden Antrag zu. Das Parlament, der Nationalrat, hatte bereits im März den Vorschlag angenommen. Dagegen hatte die Regierung, der Schweizer Bundesrat, sich ablehnend gezeigt. Der für Bildung und Forschung zuständige Bundesrat Guy Parmelin gab zu bedenken, dass allein die Abschaffung des NC das Problem nicht lösen werde.
Auch die Auswirkungen dieser Entscheidung sind unklar. Denn der Bund verfügt weder in der Ausbildung noch in der Weiterbildung über Kompetenzen, um Universitäten oder Kliniken zu verpflichten, eine bestimmte Zahl an Studienplätzen festzulegen oder klinische Praktika anzubieten. Seit 2016 versucht die Schweiz durch ein umfassendes Förderprogramm die Studienkapazitäten in der Humanmedizin zu erhöhen. Seit 2016 ist die Zahl der Master-Diplome landesweit von knapp 900 auf aktuell rund 1.200 gestiegen. Zielperspektive für das kommende Jahr sind 1.300 Studienplätze.
Doch selbst das würde nicht reichen, um die Auslandsabhängigkeit der Schweiz bei der Medizinerausbildung deutlich zu verringern. Rund die Hälfte der in der Schweiz tätigen Ärzt:innen mit abgeschlossener Weiterbildung haben ihr Medizinstudium im Ausland absolviert.
2️⃣ Forscher entlarvt die Mär der Hundertjährigen
Als der australische Forscher Saul Newman von der Oxford Universität vor fünf Jahren seine Forschung über „blaue Zonen“ veröffentlichte und diese als Mythos entlarvte, hörte kaum jemand hin. „Blaue Zonen“ sind Orte wie Okinawa in Japan, Sardinien in Italien oder Ikaria in Griechenland, wo viele Menschen angeblich ein erstaunlich langes und gesundes Leben führen. Möglicherweise wurde seine Forschung ignoriert, weil diese Ansammlung von angeblich Hundertjährigen spannenden Stoff für die Medien liefert, sogar bis hin zu einer eigenen Netflix-Dokumentation.
Aber: Leben die Menschen in diesen blauen Zonen gesünder? Sind sie weniger gestresst? Was ist ihr Geheimnis? Olivenöl, ein Glas Wein, eine vegane Ernährung? Newman konnte bei seinen Untersuchungen keine Geheimtipps für die Langlebigkeit der dortigen Menschen finden. Vielmehr kam er zu dem Schluss, dass es eigentlich gar keine blauen Zonen gibt. Stattdessen fand er an vielen dieser Orte schlampig geführte Geburten- und Sterberegister vor.
Dass seine Arbeiten nun plötzlich Gehör finden, liegt daran, dass Newman Mitte September einer von zehn Gewinnern war, die am renommierten US-amerikanischen Massachusetts Institute of Technology den sogenannten Ig-Nobelpreis (siehe auch weekly 39/2024) verliehen bekamen. Dieser “Anti-Nobelpreis” ist eine satirische Auszeichnung, um wissenschaftliche Leistungen zu ehren, die „Menschen zuerst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen“. Die wissenschaftliche Leistung des australischen Forschers ist dabei eine Analyse dokumentierter 110-Jähriger. Diese ergab, dass bei 80 Prozent der untersuchten Menschen keine ordentlichen Daten vorliegen hatten und die verbleibenden 20 Prozent aus Ländern stammten, die sich nicht sinnvoll analysieren ließen. Damit kam der Forscher zu dem Schluss: „Blaue Zonen gibt es nicht.“ Vielmehr seien die Daten hinter dem Konzept „unglaublich fehlerhaft“.
Weiterlesen auf den Seiten des Redaktionsnetzwerks Deutschland
📣 Ankündigungen
1️⃣ Interaktive Reise in die Zukunft der Medizin
Forschung und Wissenschaft sind mehr denn je aufeinander angewiesen: Wissenschaft hilft, die Welt faktenbasiert und ohne Vorurteile zu verstehen. Sie beantwortet Fragen und bringt Erkenntnisse, die zu gesellschaftlichem Fortschritt, Innovationen und besseren Lebensbedingungen für alle beitragen können. Doch was ist die Wissenschaft ohne Menschen, die sie verstehen und auf sie vertrauen? Wie kann die Forschung der Gesellschaft Antworten geben, wenn sie deren Fragen nicht kennt?
Das COSMO Wissenschaftsforum im Kulturpalast Dresden zeigt ab dem 1. Oktober 2024 die neue Ausstellung „Dr. Zukunft – Medizintechnik aus der Dresdner Wissenschaft“. Dort präsentieren Wissenschaftler:innen aus Dresdner Forschungseinrichtungen ihre aktuellen Projekte und bieten eine interaktive Reise in die Zukunft der Medizin. Die Besucher:innen können beispielsweise erfahren, wie Künstliche Intelligenz zukünftig bei der medizinischen Diagnose unterstützen wird, welche neuartigen Implantate aus Textilien bestehen und wie neue medizinische Tests entstehen. Ein echtes Ultraschallgerät, eine digitale Nase sowie Operationsgeräte zum selbst Ausprobieren warten auf das Publikum. Die Forschenden präsentieren ihre Projekte auf unterhaltsame Art: mit interaktiven Exponaten, Wissenschaftscomics, Videos und Spielen.
Weitere Informationen hier entlang
📍Wo: Dresdner Kulturpalast
📅 Wann: ab 25.09.2024, Dienstag bis Donnerstag. 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
2️⃣ Mit Krebs trotzdem gut durchs Leben
Im Wissen, dass jeder Tag im Alltag wertvoll ist, gestaltet ein engagiertes Expertenteam des CCCA (Comprehensive Cancer Center Augsburg) am Universitätsklinikum Augsburg eine Informationsveranstaltung für Erkrankte, Angehörige, Freunde und Interessierte mit Wissenswertem rund um langwierige Behandlungsphasen, damit auch Freude, Glück, vielleicht sogar Spuren von Gelassenheit einen Platz in einer schweren Zeit finden können.
Das Zusammenspiel von Vorträgen und praktischen Anleitungen bietet auch Raum für Fragen und ermöglicht ein verbessertes praktisches Verständnis. Das CCCA und das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen (NCT) im WERA-Verbund mit den Standorten Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg gestalten den Patiententag.Ausgewiesene Experten beantworten Fragen oder geben Einblicke durch Interaktive Workshops. Darunter sind auch viele MINQ-Spezialisten, wie beispielsweise Prof. Dr. Matthias Beckmann, Direktor des CCC ER-EMN2, Universitätsklinikum Erlangen, Prof. Dr. Christian Dannecker, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, CCCA1, Universitätsklinikum Augsburg oder Prof. Dr. Achim Wöckel, Klinikdirektor der Frauenklinik, CCC MF4, Universitätsklinikum Würzburg.
Das Programm kann hier als pdf geladen werden
Zur Anmeldung
📍Wo? Universitätsmedizin Göttingen
📅 Wann? Freitag, 11.10.2024, 8:30 bis 17
MINQ's weekly picks Newsletter
Melden Sie sich kostenlos an, um die neuesten Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten








