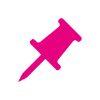🗞 17/2025
Digitaler Alltag: Gehirnjogging oder Risiko? · Klimawandel und Lungengesundheit · Innovation für Menschen mit Sehbehinderung · Was wiegen die Geisterteilchen? · Neue Farbwahrnehmung entdeckt · Deep Dive Talk with AI - diese Woche: Wie früh läßt sich Alzheimer erkennen?
📌 5 weekly picks
1 📌 Digitaler Alltag: Gehirnjogging oder Risiko?
Digitale Technologien wie Computer, Smartphones und das Internet sind unverzichtbar im Alltag, doch bleibt unklar, ob sie Fluch oder Segen für die geistige Leistung darstellen. Bisher existieren zwei konträre Hypothesen: Die erste besagt, dass lebenslange digitale Nutzung die kognitiven Fähigkeiten langfristig verschlechtert und zu mehr Demenz führt. Die zweite geht davon aus, dass regelmäßiger Umgang mit digitalen Geräten die geistige Leistung verbessert, vergleichbar mit Gehirnjogging, und Verhaltensweisen erleichtert, die die Kognition erhalten.
Dr. Jared F. Benge (University of Texas at Austin) und Dr. Michael K. Scullin, Associate Professor an der Baylor University in Texas, haben diese Hypothesen in einer Analyse untersucht. Ihre Studie ist in Nature Human Behaviour erschienen. Die Forscher werteten 57 Studien aus, die digitale Nutzung bei älteren Erwachsenen weltweit sowie deren Demenzhäufigkeit oder geistige Leistungen behandelten. Die Ergebnisse geben Einblicke in die Auswirkungen digitaler Technologien auf kognitive Gesundheit.
Das Ergebnis der Forscher zeigt, dass die Befürchtung einer digitalen Demenz unbegründet ist. Es bleibt jedoch unklar, ob digitale Geräte den geistigen Abbau aufhalten oder ob Menschen mit besserer Kognition sie häufiger nutzen. Vermutlich besteht eine Wechselwirkung.
Benge erklärt, dass die drei „C's“ – Komplexität, Beziehung und kompensatorische Verhaltensweisen – entscheidend für ein gesundes alterndes Gehirn seien. Digitale Technologien könnten komplexe Aktivitäten erleichtern, soziale Kontakte fördern und kognitiven Abbau kompensieren. Allerdings warnt Scullin: Geräte passiv wie Fernseher zu nutzen, sei wenig hilfreich.
Der Begriff digitale Demenz wurde vom Psychiater Manfred Spitzer geprägt, dessen umstrittene Thesen sich vor allem auf die Gefährdung von Kindern durch digitale Medien beziehen.
Weiterlesen auf den Seiten von Forschung und Lehre
Benge, J.F., Scullin, M.K. A meta-analysis of technology use and cognitive aging. Nat Hum Behav (2025).
https://doi.org/10.1038/s41562-025-02159-9
2 📌 Neues Positionspapier: Klimawandel und Lungengesundheit
Der Klimawandel, geprägt von steigenden Temperaturen, mehr Allergenen und häufigeren Extremwetterlagen, trifft besonders Patient:innen mit Lungenerkrankungen. Die Taskforce Klimawandel und Gesundheit der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) hat ein Positionspapier vorgelegt, das die Problematik beleuchtet und Empfehlungen zur Stärkung der Resilienz von Patient:innen sowie Gesundheitssystemen gibt. Es wird aufgezeigt, wie eine nachhaltige Gesundheitsversorgung gelingen kann.
Der Klimawandel verstärkt die Herausforderungen der Pneumologie: Höhere Feinstaub- und Ozonwerte sowie Hitzeperioden erhöhen den Medikamentenbedarf sowie die Therapieanforderungen, insbesondere bei COPD-Patienten. Laut Dr. Christian Grah vom Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe führt dies auch zu mehr Krebsneuerkrankungen – weltweit sterben jährlich sieben Millionen Menschen infolge des Klimawandels. Das Positionspapier der Fachgesellschaft betont, dass Politik, Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam Maßnahmen zur Anpassung an Klimafolgen umsetzen müssen. Der Klimawandel gefährdet besonders vulnerable Gruppen wie ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke. Für die Pneumologie gewinnt diese Entwicklung zunehmend an Bedeutung.
Zu den Autoren des Positionspapiers zählen u.a. Dr. Andrea Elmer, Dr. Sophia Kirstein, PD Dr. Stephan Walterspacher und Dr. Anastasia Weirich.
Respiratory medicine in climate change
Andrea Elmer, Christian Grah , Sophia Kirstein , Stephan Walterspacher, Anastasia Weirich
DOI: 10.1055/a-2512-2993
3 📌 Menschenzentriertes Design für Menschen mit Sehbehinderung
Für Menschen mit Sehbehinderung gibt es bereits tragbare elektronische Systeme zur visuellen Unterstützung, die sich aber bei den Anwender:innen bisher nicht durchsetzten. Ein neues Gerät mit nun "menschzentriertem Design" könnte da jetzt Abhilfe schaffen. Es zielt auf eine bessere Benutzerfreundlichkeit und soll für Menschen mit Sehbehinderung besonders komfortabel sein. Das neue System nutzt Software-Innovationen, wie z. B. die Anpassung des KI-Algorithmus an die Anforderungen eines individuellen Anwendungsszenarios und berücksichtigt das jeweilige menschliche Verhalten. Hardware-Verbesserungen umfassen die Entwicklung von dehnbaren sensorisch-motorischen "künstlichen Häuten" zur Ergänzung des Audio-Feedbacks und zur Unterstützung visueller Aufgaben durch haptisches Feedback. Das System integriert auch "selbstbetriebene triboelektrische intelligente Einlegesohlen", um die effektive Schulung der Benutzer in sorgfältig gestalteten virtuellen Szenarien zu unterstützen.
Gegenüber bisherigen Anwendungen kombiniert das System visuelle, akustische und haptische Sinne und ermöglicht Verbesserungen bei Navigationsaufgaben. Videoaufzeichnungen von Tests zeigen zeigen sehbehinderte Personen, die sicher durch ein Labyrinth, einen unübersichtlichen Konferenzraum, oder einen schmalen Korridor navigieren.
Die Studie mit dem Titel "Human-centred design and fabrication of a wearable multimodal visual assistance system" wurde im Journal Nature Machine Intelligence veröffentlicht.
4 📌 Was wiegen die Geisterteilchen?
Neutrinos gehören zu den rätselhaftesten Teilchen des Universums. Sie sind allgegenwärtig, reagieren aber äußerst selten mit Materie. In der Kosmologie beeinflussen Neutrinos die Entwicklung großräumiger Strukturen, während sie in der Teilchenphysik aufgrund ihrer winzigen Masse als Indikatoren für bisher unbekannte physikalische Prozesse dienen. Die präzise Messung der Neutrinomasse ist daher essenziell für ein vollständiges Verständnis der fundamentalen Gesetze der Natur. Genau hier setzt das KArlsruhe TRItium Neutrino Experiment (KATRIN) mit seinen internationalen Partnern an. KATRIN nutzt den Beta-Zerfall von Tritium, einem instabilen Wasserstoffisotop, um mithilfe der Energieverteilung der entstehenden Elektronen die Neutrinomasse zu messen. Um dies zu erreichen, sind hochentwickelte technische Komponenten notwendig: Das 70 Meter lange Experiment beherbergt eine intensive Tritiumquelle sowie ein hochauflösendes Spektrometer mit einem Durchmesser von zehn Metern. Diese Technologie ermöglicht eine bislang unerreichte Präzision bei der Messung der Neutrinomasse.

Jetzt hat KATRIN am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Maßstäbe gesetzt: Aus den aktuellen Daten lässt sich eine unvorstellbare Obergrenze von 0,45 Elektronenvolt/c2 (entspricht 8 x 10-37 Kilogramm) für die Masse des Neutrinos ableiten. Damit stellt KATRIN, das die Neutrinomasse mit einer modellunabhängigen Methode im Labor vermisst, erneut einen Weltrekord auf. Mit den ersten Daten wurden die Ergebnisse früherer Experimente um das Vierfache übertroffen. Das aktuelle Resultat zeigt, dass Neutrinos mindestens eine Million Mal leichter sind als Elektronen, die leichtesten geladenen Elementarteilchen. Diesen enormen Massenunterschied zu erklären, bleibt eine Herausforderung für die Theoretische Teilchenphysik. Die Ergebnisse haben die Forschenden jetzt in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht
KATRIN Collaboration† et al. ,Direct neutrino-mass measurement based on 259 days of KATRIN data. Science 388,180-185(2025).
DOI:10.1126/science.adq9592
In einer virtuellen Tour gewähren die Physiker:innen vom KIT höchst anschaulich und sehr informativ Einblicke in die Welt des KATRIN und erklären die Vorgänge während des Experiments. Sehenswert!

5 📌 ”Alles in OLO” - Neue Farbwahrnehmung entdeckt
Forschende der University of California haben mit Hilfe von Laserstrahlen eine neue Farbe namens „OLO“ erzeugt, die im Farbspektrum bisher nicht wahrnehmbar war. Diese blau-grüne, brillante Farbe wird durch gezielte Stimulation der Sinneszellen (Zapfen) in der Netzhaut sichtbar. Ren Ng, Elektroingenieur, erklärt, dass die Technologie einzelne Zapfen aktivieren kann, ohne benachbarte Zellen zu beeinflussen. Das System, entwickelt von Austin Roorda, nutzt präzise Optik und Echtzeit-Tracking, um kleinste Augenbewegungen auszugleichen. Tausende Lichtimpulse pro Sekunde stimulieren gezielt die gewünschten Farbzellen. Durch diese Methode haben die Forschenden nicht nur eine neue Farbe entdeckt, sondern auch Erkenntnisse zur Lichtsignalverarbeitung in der Netzhaut gewonnen. Praktische Anwendungen umfassen potenzielle Behandlungen von Farbenblindheit und Erweiterungen der Farbwahrnehmung. Auch neue Displaytechnologien und intensivere virtuelle Realitäten könnten von dieser Technik profitieren. Das System ermöglicht präzise Experimente zur Simulation von Netzhaut-Verlusten oder zur Verbesserung des Sehvermögens bei rot-grün-blinden Menschen. Es zeigt, wie leistungsfähig die Stimulation der Netzhaut geworden ist und eröffnet neue Forschungsperspektiven.
Weiterlesen auf den Seiten von ingenieur und science
James Fong et al. ,Novel color via stimulation of individual photoreceptors at population scale.Sci. Adv.11, eadu1052(2025).
DOI:10.1126/sciadv.adu1052
PLUS …
🧠 Deep Dive Talk with AI
Diese Woche: Wie früh läßt sich Alzheimer erkennen?
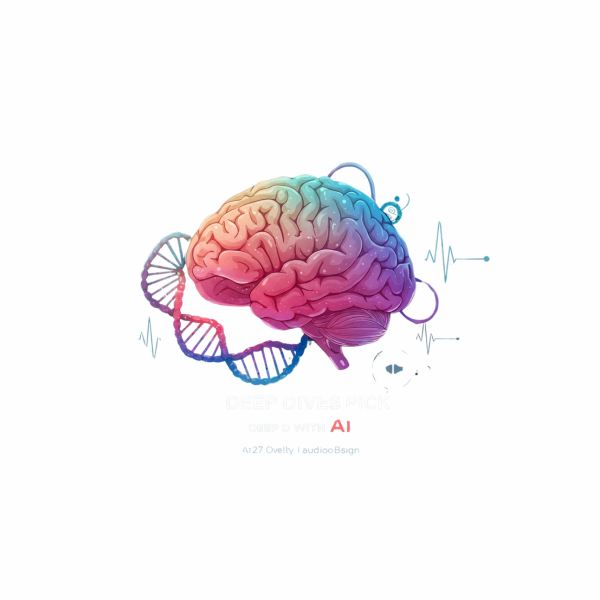
💬 Über unseren Tellerrand
1️⃣ Elektromagnetische Felder in E-Autos: Belastung oder unbedenklich?
Müssen Fahrende von Elektroautos starke elektromagnetische Felder befürchten? Neue Messungen des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) belegen, dass die getesteten E-Autos deutlich unter den empfohlenen Höchstwerten liegen. Im Gegenteil: Bei einigen Hybrid- und Verbrennerfahrzeugen war die Belastung sogar stellenweise höher. Elektromagnetische Felder entstehen überall, wo Strom fließt. Ab einer bestimmten Stärke können nieder- und mittelfrequente Felder jedoch gesundheitliche Folgen haben: Sie erzeugen elektrische Ströme im Körper, die Nerven und Muskeln reizen. Daher gibt es strenge Höchstwerte gemäß deutschen und europäischen Richtlinien.
In Elektroautos generieren Akkus, Elektromotoren und Komponenten zusätzliche Felder. Auch Klimaanlagen, Lüfter und andere elektrische Geräte in Fahrzeugen tragen dazu bei. In E-Autos sind jedoch noch stärkere Quellen präsent, wie Hochvoltverkabelung, Wechselrichter und der Elektromotor. Das BfS untersuchte die Magnetfeldbelastung von elf E-Auto-Modellen (Baujahre 2019–2021) wie Tesla Model 3, Renault Zoe, BMW i3, VW ID.3 und Audi e-tron quattro. Zum Vergleich wurden zwei Hybridautos und ein Verbrenner getestet. Messungen fanden auf Rollenprüfständen, Teststrecken und im Straßenverkehr statt. Alle Modelle blieben unter den empfohlenen Grenzwerten.
Interessant jedoch: Es gab große Unterschiede zwischen den verschiedenen Elektroauto-Modellen. So traten beispielsweise beim Mercedes GLE 350 Hybrid eine auffällig hohe Magnetfeldbelastung im Fußbereich auf, die vermutlich durch eine ungünstig untergebrachte Verkabelung verursacht wird. Bei Tesla Model 3 und BMW i3 sind auch Passagiere auf der Rückbank im Unterleibsbereich etwas erhöhten Werten ausgesetzt.
Mehr Informationen auf den Seiten von scinexx. Hier gehts zum gesamten Ergebnisbericht
2️⃣ Sex als Friedensstifter? Konfliktlösung durch soziosexuelles Verhalten

Sex dient nicht nur der Fortpflanzung, sondern erfüllt auch soziale Funktionen – sowohl beim Menschen als auch bei Bonobos und Schimpansen. Eine Studie der University of Durham zeigt, wie diese Primaten Sex nutzen, um Konflikte zu lösen und Beziehungen zu stärken. Die Forscher beobachteten 53 Bonobos und 75 Schimpansen über sieben Monate hinweg und sammelten 1.400 Stunden Verhaltensdaten. Sie analysierten soziosexuelles Verhalten, das Vertrauen stärkt, Bindungen fördert und Stress abbaut. Bonobos nutzen Sex häufiger zur Versöhnung nach Konflikten, während Schimpansen andere Verhaltensweisen wie Körperküsse bevorzugen. Vor der Fütterung war die Häufigkeit genitaler Kontakte bei beiden Arten ähnlich. Weibliche Bonobos und männliche Schimpansen initiierten häufiger Sex, besonders zwischen nicht-verwandten Tieren. Ältere Tiere zeigten vor der Fütterung häufiger soziosexuelles Verhalten, was auf erlernte Verhaltensweisen hinweist.
Die Studie liefert Einblicke in unsere evolutionäre Vergangenheit und zeigt, dass Menschen, Bonobos und Schimpansen soziale Funktionen von Sex von gemeinsamen Vorfahren geerbt haben. Auch beim Menschen stärkt Sex Vertrauen, Bindungen und emotionales Wohlbefinden.
Weitere Infos hierzu auf den Seiten von telepolis
Brooker JS, Webb CE, vanLeeuwen EJC, Kordon S, de Waal FBM, Clay Z. 2025 Bonobos and chimpanzees overlap in sexualbehaviour patterns during social tension. R. Soc.Open Sci. 12: 242031
https://doi.org/10.1098/rsos.242031
📣 Ankündigungen
1️⃣ Zum Tag gegen den Schlaganfall: Infos zur Aphasie
Die Unimedizin Greifswald veranstaltet anlässlich des Tages gegen den Schlaganfall eine Informationsveranstaltung für Betroffene, Angehörige, medizinisches Personal und Interessierte. Fachleute der Klinik und Poliklinik für Neurologie sowie externe Experten klären über Risiken, Symptome, Folgen und Therapiemöglichkeiten eines Schlaganfalls auf. Im Fokus steht die Aphasie, eine Sprachstörung, die oft nach einem Schlaganfall auftritt. Die Veranstaltung bietet auch Raum für Austausch unter Betroffenen.
Teilnehmende des Kunstworkshops „AphasieArt“ zeigen ihre Werke unter dem Thema „Frühlingserwachen“. Der Workshop wurde vom Landesverband für die Rehabilitation der Aphasiker in MV e.V. organisiert.
📅 Wann: 6. Mai, ab 14.30 Uhr
📍 Wo: Universitätsmedizin Greifswald (Seminarraum für Innere Medizin A, Flur 7)
2️⃣ Patienteninformationstag zur häufigsten Krebserkrankung des Mannes
Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern, weshalb Vorsorge, Diagnostik und Therapie essenziell sind. Moderne bildgebende Verfahren haben einen festen Platz in der Diagnostik, während neue Entwicklungen in der operativen und Strahlentherapie das Behandlungsspektrum erweitern. Patienten mit metastasiertem Prostatakrebs profitieren von zahlreichen wirksamen Medikamenten und Kombinationstherapien. Namhafte Experten beleuchten auf der Veranstaltung verschiedene Aspekte des Prostatakrebses und teilen ihre Erfahrungen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf einer ganzheitlichen Betreuung, die durch die enge Zusammenarbeit der Fachabteilungen im Zentrum gewährleistet wird. Zum Abschluss können die Teilnehmer ihre persönlichen Fragen direkt mit den Referenten besprechen.
📅 Wann: 10. Mai 2025, 10 bis 14 Uhr
📍 Wo: Hörsaal des Zentrums für Operative Medizin (ZOM), Oberdürrbacher Str. 6, 97080 Würzburg
Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Zum Programmablauf
🤕 IchalsPatient
1️⃣ KI als Hilfestellung im Alltag: Der Parkinson Berater
Der Parkinson Berater - eine speziell entwickelte künstliche Intelligenz - könnte vielen Patient:innen und deren Angehörigen den Alltag erleichtern. Er vereint das umfangreiche Wissen von ChatGPT mit den Inhalten des Parkinson Journals, des Parkinson Kompasses, des Parkinson Praxisbuches, den Parkinson Leitlinien – und insbesondere den Vorträgen der Parkinson-Schule – zu einer gebündelten Wissensplattform rund um das Thema Parkinson. Der Parkinson Berater beantwortet frei formulierte Fragen in natürlicher Sprache – umfassend, verständlich und auf Augenhöhe. Gleichzeitig werden passende Artikel aus dem Parkinson Journal oder Beiträge aus der Mediathek der Parkinson-Schule in einer übersichtlichen Trefferliste angeboten.
Er ersetzt nicht die ärztliche Beratung, dient aber beispielsweise zur Vorbereitung auf ein Arztgespräch.
weitere Infos gibt es hier
2️⃣ Bewusstseinsstörungen: Neue Einblicke und diagnostische Herausforderungen
“Vielleicht sind viele Patient:innen gar nicht so komatös wie wir denken?” Menschen mit schweren Bewusstseinsstörungen reagieren nicht immer sichtbar auf Aufforderungen, doch dies bedeutet nicht zwingend, dass sie die Aufforderungen nicht wahrnehmen oder kognitiv nicht bewältigen können. Die Neurologin Prof. Angelika Alonso vom Uniklinikum Mannheim erläutert, dass Bewusstseinsstörungen in Koma, Unresponsive Wakefulness Syndrome (UWS) und Minimally Conscious State (MCS) unterteilt werden, wobei das MCS weiter in MCS+ und MCS- differenziert wird. Beim MCS+ können Betroffene Aufforderungen folgen, jedoch inkonstant und unvollständig, während beim MCS- nur minimale Bewusstseinsfunktionen, wie das Fixieren mit den Augen, erkennbar sind.
Alonso empfiehlt, ältere Begriffe wie "vegetativer Status" oder "Wachkoma" nicht zu verwenden und rät zur Anwendung der Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R). Die Cognitive Motor Dissociation (CMD), erstmals 2015 beschrieben, betrifft Personen, die äußerlich nicht reagieren, jedoch kognitive Aufgaben lösen können. Die CMD ist ohne apparative Verfahren nicht von anderen Bewusstseinsstörungen unterscheidbar. Studien haben fMRT- und EEG-Untersuchungen genutzt, wobei automatisierte Pupillometrie vielversprechend erscheint. Laut einer dänischen Studie zeigen 18 % der von UWS- oder Koma-Betroffenen Pupillendilatation unter mentaler Belastung. CMD ist schwer diagnostizierbar, mit geschätzten Prävalenzen von 14-19 % bei UWS. Eine Kohortenstudie zeigte, dass ein Viertel der klinisch diagnostizierten Koma-, UWS- oder MCS-Betroffenen die CMD-Kriterien erfüllte.
Alonso betont, dass viele Patienten möglicherweise weniger komatös sind als vermutet.
Cognitive Motor Dissociation in Disorders of Consciousness Authors: Yelena G. Bodien, Ph.D. et.al.
Published August 14, 2024 N Engl J Med 2024; 391:598-608
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2400645
Zum Artikel in Springermedizin
MINQ's weekly picks Newsletter
Melden Sie sich kostenlos an, um die neuesten Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten