
🗞 6/2025
Anstieg des Mikroplastiks im Gehirn · "Kognitive Beeinträchtigung" bei ChatGPT · Onkologie-Patente: Europa lahmt · Hirnschrittmacher können remote gesteuert werden · Im Süden glücklicher - Limes bildet bis heute psychologische Grenze · 🤕 IchalsPatient: KI-Video von Heidis Rettung
📌 5 weekly picks
1 📌 Anstieg des Mikroplastiks in unserem Gehirn: “Our brains are filling with more and more microplastics”
Die Menge an Mikroplastik und Nanoplastik (MNPs) in unserer Umwelt nimmt zu. Verschiedene Untersuchungsmethoden haben das Vorhandensein von MNPs in menschlichen Nieren, Leber und Gehirn bestätigt. Die häufigste Plastikart in diesen Organen ist Polyethylen, aber auch andere Plastikarten wurden gefunden. Eine neue Studie in Nature Medicine zeigt, dass das Gehirngewebe mehr Polyethylen enthält als die Leber oder Nieren. Diese Plastikteilchen im Gehirn sind oft sehr klein und scharfkantig. Interessanterweise hängen die Plastikmengen in diesen Geweben nicht vom Alter, Geschlecht, der ethnischen Zugehörigkeit oder Todesursache der Verstorbenen ab. Allerdings wurden im Laufe der Zeit immer höhere Mengen an Mikroplastik in Leber- und Gehirngeweben gefunden (von 2016 bis 2024). Besonders besorgniserregend ist, dass noch mehr Mikroplastik in den Gehirnen von verstorbenen Menschen mit Demenz gefunden wurde, vor allem in den Blutgefäßen und Immunzellen.
"Jedes Mal, wenn wir an der Oberfläche kratzen, löst es eine ganze Reihe von ‘Oh, das ist schlimmer, als wir dachten?’ aus”, sagt einer der Hauptautoren des Papiers, Matthew Campen, Professor für Toxikologie an der University of New Mexico, in einem Interview gegenüber der Washington Post. Für die neue Studie analysierten Wissenschaftler 52 Gehirnproben, 28, die 2016 autopsiert wurden, und 24, die 2024 autopsiert wurden. Sie fanden Mikroplastik in jeder Probe, aber es gab signifikant höhere Konzentrationen von Mikroplastik in denen ab 2024. Die Ergebnisse zeigen nach Ansicht von Phoebe Stapleton, Professorin für Pharmakologie und Toxikologie an der Rutgers University, die nicht an der Studie beteiligt war, “eindeutige Beweise dafür, dass Mikro- und Nanoplastik tatsächlich im menschlichen Gehirn enthalten sind". Das Papier zeigte auch, dass das Gehirn anfälliger für Mikroplastik zu sein scheint als andere Organe - Gehirnproben hatten sieben- bis 30-mal so viel Mikroplastik wie Leber- und Nierenproben.
Zum gesamten Artikel in der Washington Post
Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains
Nihart, A.J., Garcia, M.A., El Hayek, E. et al. Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains. Nat Med (2025). https://doi.org/10.1038/s41591-024-03453-1
2 📌 Kognitive Beeinträchtigung bei ChatGPT und Co
In vielen Studien geht es darum, dass Künstliche Intelligenz (KI) Patientendaten besser auslesen und Diagnosen schneller erstellen könnte als Ärzt:innen. Eine neue Studie, veröffentlicht im „British Medical Journal“, hat die kognitiven Fähigkeiten führender Sprachmodelle untersucht – mit überraschenden Ergebnissen: Fast alle getesteten großen Chatbots bestehen kognitive Tests, die für Menschen entwickelt wurden, nicht in allen Bereichen gut. Das heißt, die Modelle zeigen Anzeichen einer leichten kognitiven Beeinträchtigung.
Alle Chatbots zeigten schwache Leistungen bei visuell-räumlichen Fähigkeiten und exekutiven Aufgaben, wie der Aufgabe, eingekreiste Zahlen und Buchstaben in aufsteigender Reihenfolge zu verbinden. Auch beim Zeichnen eines Ziffernblatts mit einer bestimmten Uhrzeit schnitten die sogenannten Large Language Models (LLMs) schwach ab. Die Forscher nutzten den Montreal Cognitive Assessment (MoCA) Test, der üblicherweise bei Menschen eingesetzt wird, um frühe Anzeichen von Demenz zu erkennen. Der Test bewertet Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprache, visuell-räumliche Wahrnehmung und exekutive Funktionen. Die Höchstpunktzahl liegt bei 30, ein Wert von 26 oder höher gilt als normal.
„Es ist nicht nur unwahrscheinlich, dass Neurolog:innen in absehbarer Zeit durch große Sprachmodelle ersetzt werden, sondern unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese bald neue, virtuelle Patienten behandeln könnten – Modelle künstlicher Intelligenz, die kognitive Beeinträchtigungen aufweisen“, folgert die Arbeitsgruppe aus ihren Ergebnissen.
Zum Artikel im Ärzteblatt
Age against the machine—susceptibility of large language models to cognitive impairment: cross sectional analysis im British Medical Journal
DOI: https://doi.org/10.1136/bmj-2024-081948
3 📌 Onkologie-Patente: Europa lahmt, USA und China vorne
Kein neues Phänomen: Europa verliert gegenüber den USA und China an Boden. Sowohl bei der Digitalisierung als auch bei KI, Robotik und Elektroautos. Leider auch in der Onkologie-Forschung, wie eine Studie des Europäischen Patentamtes zeigt. Die Studie "Neue Horizonte in der Onkologie: ein Innovationsökosystem im Wandel" fächert auf, wie stark das Wachstum bei verschiedenen Technologien zur Diagnose und Therapie von Krebs ist. Sie stellt Daten zu Start-ups vor, die neue Technologien zur Krebsbekämpfung entwickeln, schildert die Beiträge von Hochschulen, Krankenhäusern und öffentlichen Forschungseinrichtungen und zeigt die Unterschiede zwischen den USA und Europa bei der Zahl der Start-ups auf, die die Reifephase erreichen.
Wie die Studie zeigt, kann Europa in den wachstumsstärksten Feldern mit innovativen Krebstechnologien nicht mit den Patentanmeldungen in den USA und China mithalten – und das, obwohl Europa die größte Zahl von krebsbezogenen Start-ups aufweisen kann. In der Studie wurden Patentanmeldungen in 28 krebsbezogenen Technologiefeldern untersucht, mit dem Ergebnis, dass die Wachstumsraten und die absolute Anzahl der internationalen Patentfamilien beträchtlich voneinander abwichen. In der jüngsten Untersuchungsphase (2015–2021) gehörten Technologien wie zelluläre Immuntheraphie (+37,8 %), Gentherapie (+31,0 %), Bildanalyse (19,6 %), Liquid Biopsy (+17,2 %) und medizinische Informatik (+14,7 %) zu den größten Wachstumsbereichen
"Angesichts von Mario Draghis Bericht zur Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit sind die Ergebnisse dieser Studie ein Weckruf für das europäische Innovationssystem für Krebsforschung", so EPA-Präsident António Campinos. "Technologien zur Krebsbekämpfung entwickeln sich rasch und gegebenenfalls in unerwartete Richtungen. Europa muss jetzt reagieren, um seinen Wettbewerbsvorsprung bei innovativer Gesundheitstechnologie zu wahren und Leben zu retten. Dass es in Europa so viele Start-ups in der Krebstechnologie gibt, ist ein Lichtblick, aber diese Unternehmen benötigen Investitionen und Unterstützung, um ihre Erfindungen zu skalieren."
Weiterlesen auf den Seiten des Europäischen Patentamtes
New frontiers in oncology: an evolving innovation ecosystem
4 📌 Ohne Anreise: Implantate wie Hirnschrittmacher können remote gesteuert werden
Chronische Erkrankungen wie Herzerkrankungen, Hörverlust oder neurodegenerative Erkrankungen nehmen weltweit zu und stellen Patient:innen und Gesundheitssysteme vor enorme Herausforderungen. Aktive Implantate wie Herz- oder Hirnschrittmacher , Vagusnerv-Stimulatoren bei Epilepsie oder Cochlea-Implantate können Behandlungsergebnisse verbessern. Bislang war die Nachsorge dieser Systeme oft mit aufwändigen Klinikbesuchen verbunden. Eine aktuelle Studie des Universitätsklinikums Tübingen mit internationalen Partnern zeigt aber, dass die Einstellung solcher aktiven Implantate auch zuverlässig und effektiv aus der Ferne über das Internet erfolgen könnte.
„Mit der Fernanpassung aktiver Implantate möchten wir höchste Behandlungsqualität mit maximalem Komfort für Menschen mit den unterschiedlichsten Einschränkungen ermöglichen“, erklärt Prof. Dr. Alireza Gharabaghi, Ärztlicher Direktor des Instituts für Neuromodulation und Neurotechnologie, der die weltweite Studie zusammen mit siebzehn weiteren spezialisierten Zentren für die Behandlung von Parkinson durchgeführt hat.
In der Studie wurden Patient:innen mit Parkinson und einem Schrittmacher zur tiefen Hirnstimulation untersucht. Mithilfe einer Smartwatch wurde in den ersten drei Monaten nach der OP die Beweglichkeit gemessen, diese ist bei Parkinson häufig eingeschränkt. Zusätzlich erhielten die Patient:innen täglich kurze Nachrichten auf das Smartphone, um ihr Befinden zu erfragen. Bei Bedarf konnten sie einen Termin mit den behandelnden Ärzten vereinbaren, der als Videobesprechung über das Smartphone durchgeführt wurde. Stellte sich dabei heraus, dass der Schrittmacher angepasst werden musste, konnten die Patient:innen ihr Gerät vorübergehend freischalten, sodass die Behandelnden die Einstellungen aus der Ferne anpassen konnten.
„Mit dieser Technologie können wir den Zugang zur Versorgung verbessern und Patient:innen eine deutlich angenehmere Betreuung bieten – insbesondere bei chronischen Erkrankungen, die eine regelmäßige Nachsorge erfordern“, so Gharabaghi. Die Fernanpassung macht es zudem möglich, die Therapien in Zukunft auch in Bereichen zu verbessern, die bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. Denn für eine gute Lebensqualität sind nicht nur motorische Aspekte, sondern auch nicht-motorische Faktoren wie Kognition oder Schlafqualität wichtig. Die vielfältigen Daten, die im Alltag beispielsweise durch das Tragen der Smartwatch entstehen, können dafür künftig genutzt werden.
Zur Pressemeldung des UK Tübingen
Accelerated symptom improvement in Parkinson’s disease via remote internet-based optimization of deep brain stimulation therapy: a randomized, controlled multicenter trial
DOI: doi.org/10.1038/s43856-025-00744-7
5 📌 Im Süden lebt es sich glücklicher - Römischer Limes bildet bis heute psychologische Grenze
In Deutschland gab es unterschiedliche Sozialisationen und Befindlichkeiten dies- und jenseits der Berliner Mauer bzw. der innerdeutschen Grenze, die bis heute fortwirken. Eine aktuelle internationale Studie zeigt nun, wie stark selbst eine fast zweitausend Jahre zurückliegende räumliche Trennung die Psychologie in der Gegenwart prägen kann: Der Limes bildet eine andere „psychologische Grenze“, die Deutschland teilt. Der Bereich südlich des römischen Grenzwalls weist laut Studienergebnissen höhere Werte in Lebenszufriedenheit, Lebenserwartung und damit verbundenen Persönlichkeitsmerkmalen auf als der nördliche Bereich. Überraschend klar zeichnet sich in diesen heutigen psychologischen Landkarten Deutschlands eine Grenze entlang des ehemaligen Limes ab.
Forscher:innen der Universität Jena sowie anderer internationaler Hochschulen analysierten umfangreiche psychologische Daten von mehr als 70.000 Befragten. Sie verglichen Regionen südlich des Limes, die Teil des römischen Reiches waren, mit den Gebieten darüber hinaus, die außerhalb des römischen Einflusses blieben. Das Ergebnis zeigt eine deutliche Trennlinie: In den ehemaligen römischen Regionen weisen Menschen im Durchschnitt mehr Extraversion, eine höhere Gewissenhaftigkeit und geringeren Neurotizismus auf – Eigenschaften, die mit Wohlbefinden und einem gesunden Lebensstil verbunden sind.
Professor Dr. Martin Obschonka von der Universität Amsterdam erklärt: „Unsere Studie zeigt, dass historische Ereignisse, selbst wenn sie Jahrtausende zurückliegen, langanhaltende psychologische Effekte haben können.“ Dies legt nahe, dass der römische Einfluss nicht nur in wirtschaftlichen und infrastrukturellen Hinterlassenschaften sichtbar ist, sondern auch in der psychologischen Prägung der Bevölkerung. Besonders auffällig ist, dass diese Unterschiede bestehen bleiben, selbst wenn moderne Einflussfaktoren wie Wirtschaft, Bildung und Infrastruktur mit einbezogen werden. Dies deutet darauf hin, dass sich gesellschaftliche und kulturelle Prägungen über Generationen hinweg erhalten und auf die heutigen Lebensbedingungen auswirken.
Denn: Die Römer brachten nicht nur Straßennetze, Märkte und Verwaltungssysteme mit, sondern auch eine Kultur, die auf Wohlstand, Hygiene und Fortschritt setzte. Diese Faktoren hatten nachhaltige Auswirkungen auf die Bevölkerung der besetzten Gebiete. Sie entwickelten sich wirtschaftlich und gesellschaftlich weiter, was wiederum langfristige kulturelle und psychologische Vorteile mit sich brachte.
Weiterlesen auf den Seiten der Uni Jena
Martin Obschonka, Fabian Wahl, Michael Fritsch, Michael Wyrwich, P. Jason Rentfrow, Jeff Potter, Samuel D. Gosling: Roma Eterna? Roman Rule Explains Regional Well-Being Divides in Germany
DOI: 10.1016/j.cresp.2025.100214
💬 Über unseren Tellerrand
1️⃣ Japan: Angst vor dem Älterwerden führt zu Straftaten
Kurios: Die neuen Statistiken über Häftlinge in Japan besagen, dass rund 80 Prozent der weiblichen Häftlinge im vergangenen Jahr wegen Diebstahls oder Verstößen gegen die Drogengesetze verurteilt wurden. 22,7 Prozent der weiblichen Häftlinge waren 65 Jahre oder älter, was einem Anstieg um das 4,2-fache seit 2004 entspricht. Man vermutet tatsächlich, dass die Angst vor dem Älterwerden und die Isolation zu Straftaten beitragen.
Insgesamt wurden vom Justizministerium 900 männliche und weibliche Häftlinge, die wegen Diebstahls oder Drogendelikten eine Haftstrafe verbüßen, befragt. In der Altersgruppe der über 60 Jährigen haben 95,6 Prozent der weiblichen Häftlinge Ladendiebstähle begangen, bei den Männer waren es 48,3 Prozent. Bei den Frauen war das am häufigsten genannte Motiv „Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen“ mit 37,4 Prozent und 38,7 Prozent lebten allein.
“Wir müssen ihre Windeln wechseln, helfen ihnen beim Baden und Essen – das fühlt sich hier mehr wie ein Altersheim als eine Haftanstalt an”, sagte ein Aufseher in Japans grösstem Frauengefängnis in Tochigi kürzlich dem Sender CNN.
Ein Fünftel aller Japaner über 65 lebt unter der Armutsgrenze. Viele könnten das Leben hinter Gittern der Altersarmut in Freiheit vorziehen. Es sind Grundbedürfnisse: Die Frauen wollten etwas zu essen, etwas zu tun und vor allem Anschluss. Die Isolation im Alter macht vielen zu schaffen.
Weiterlesen auf den Seiten von Sumikai und der nzz
2️⃣ Sturzprävention: Tierische Fußsohlen als Vorbild
Gibt es endlich eine sinnvolle Lösung, um Verletzungen durch Ausrutschen und Stürzen vorzubeugen? Möglicherweise findet man sie im Reich der Echsen… Denn die Fußsohlen von Geckos - übrigens Zootier des Jahres 2024 - haben hydrophile (wasserliebende) Mechanismen, die es den kleinen Tieren ermöglichen, sich leicht über feuchte, glatte Oberflächen zu bewegen.

Forscher berichten in ACS Applied Materials & Interfaces, dass sie Silikonkautschuk mit Zirkoniumdioxid-Nanopartikeln angereichert haben, um ein von Geckos inspiriertes, rutschfestes Polymer herzustellen. Das Material, das auf Eis haftet, könnte in Schuhsohlen eingebaut werden, um Verletzungen beim Menschen zu verringern.
Nach Angaben der WHO sind Ausrutscher und Stürze jedes Jahr für mehr als 38 Millionen Verletzungen und 684.000 Todesfälle verantwortlich. Und fast die Hälfte dieser Unfälle ereignet sich auf Eis. Derzeitige rutschfeste Schuhsohlen basieren auf Materialien wie Naturkautschuk. Auf gefrorenen Gehwegen können Schuhsohlen mit diesen Materialien jedoch dazu führen, dass das Eis durch den Druck des Trägers schmilzt und die rutschige Oberfläche entsteht, vor der die Schuhe eigentlich schützen sollen.
Frühere Studien an Geckofüßen haben zu neuen Ideen für die Entwicklung wirksamerer rutschhemmender Polymere geführt. In diesen Arbeiten wurde festgestellt, dass die Klebrigkeit der Fußsohlen durch hydrophile, kapillarverstärkte Adhäsion zustande kommt: Die Kraft des Wassers, das in schmale Rillen im Fußballen gesaugt wird, erzeugt einen Sog, der der Eidechse hilft, auf rutschigen Oberflächen zu navigieren. Vipin Richhariya, Ashis Tripathy, Md Julker Nine und Kollegen fanden mithilfe von Infrarotspektroskopie und simulierten Reibungstests heraus, dass die rutschfestesten Nanokomposite 3 und 5 Gewichtsprozent Zirkoniumdioxid-Nanopartikel enthielten. Neben einer von der Natur inspirierten rutschfesten Schuhsohle könnte diese Technologie laut dem Team auch für medizinische Innovationen wie elektronische Haut und künstliche Haut verwendet werden, bei denen Polymere mit einer Flüssigkeitsschicht zwischen zwei verschiedenen Oberflächen interagieren.
Weiterlesen auf den Seiten von chemeurope
📺 Hingeschaut
„Medfluencer“ teilen fragwürdige Gesundheitstipps
Gesundheitstipps auf Social Media sind nicht mehr wegzudenken. Viele Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden googeln ihre Symptome oder vertrauen dem Content von sogenannten Medfluencern – „medical influencern“. Egal, ob diese reichweitenstarken Medfluencer eine medizinische Ausbildung haben, oder nicht. Recherchen von „Vollbild“ zeigen: Neben Werbung propagieren sie auch gesundheitsschädliche Tipps oder sogar Verschwörungsmythen. Ihr Content boomt auf Social Media. Doch unter seriöse Aufklärung von Ärzten mischen sich auch Influencer ohne medizinische Qualifikation. Manchen geht es offenbar hauptsächlich darum, Produkte zu verkaufen. Und einige teilen sogar Verschwörungsmythen.
Weitere Infos zur Sendung auf den Seiten des SWR
📣 Ankündigungen
1️⃣ „Planet Radiology“ - Kongress der ECR Radiologie in Wien
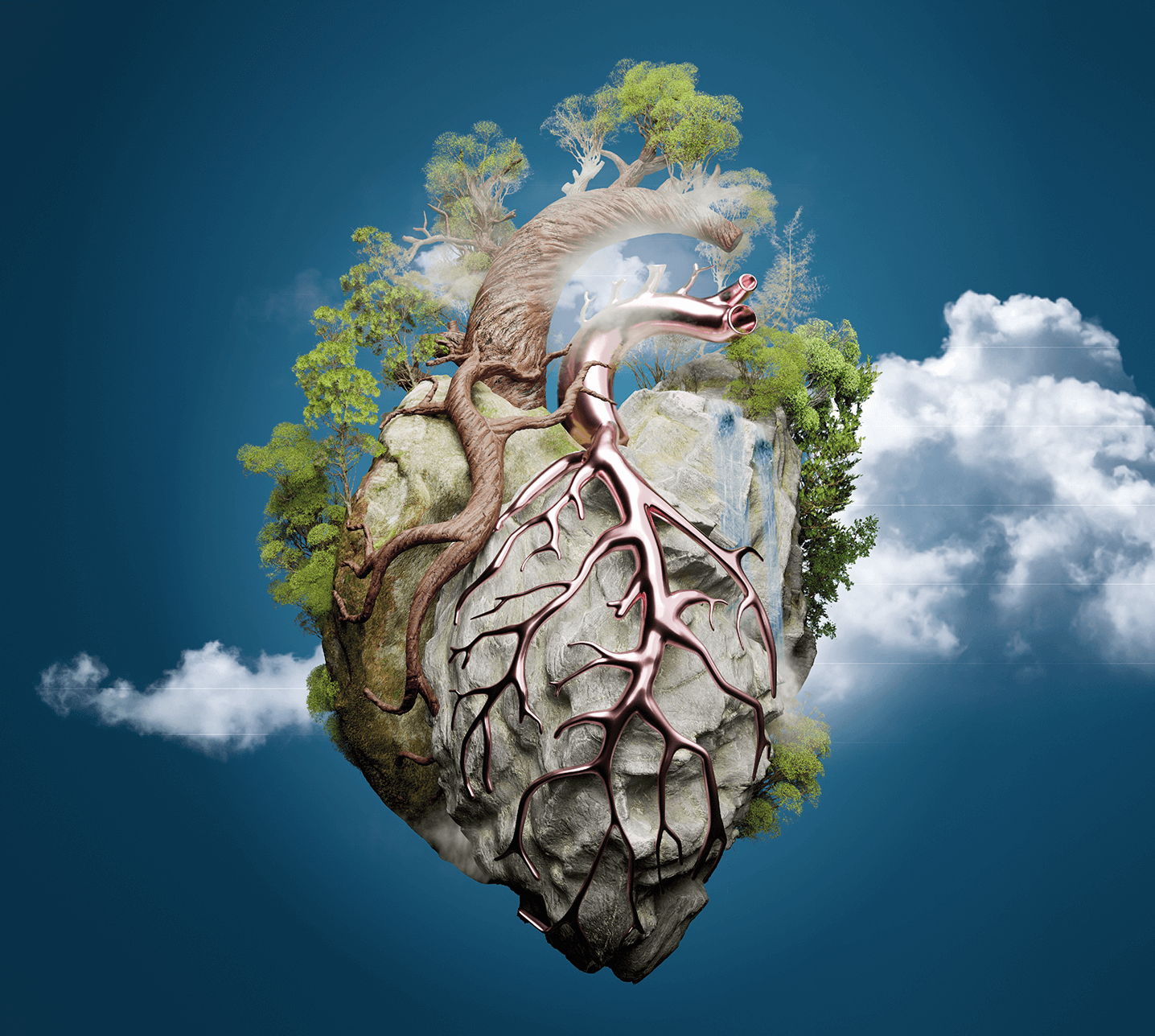
Das ECR 2025-Poster greift das Kongressthema „Planet Radiology“ auf und soll dazu einladen, darüber nachzudenken, wie sich die Radiologie auf die Welt auswirkt. Als Europas größter Kongress für Radiologie und Bildgebung repräsentiert der ECR ein ganzes Ökosystem aus Wissenschaft, Innovation und Vernetzung. Im Zentrum stehen u.a. die Fragen, wie Radiologen ihre Praktiken, Technologien und Denkweisen anpassen und verbessern könnten und wie sich das Fachgebiet umweltfreundlicher und sozial verantwortlicher entwickeln könnte. Zudem werden Innovationen in der Radiologie thematisiert, die auch zur Nachhaltigkeit beitragen.
Weitere Informationen hier entlang
📅 Wann: 26. Februar – 2. März 2025
📍 Wo: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, Österreich
2️⃣ Patellofemoral-Kongress der deutschen Kniegesellschaft
Die Deutsche Kniegesellschaft veranstaltet wieder einen Patellofemoral-Kongress. MINQ-Spezialist Prof. Dr. med. M. Perl von der Unfallchirurgischen und Orthopädischen Klinik am Universitätsklinikum Erlangen lädt als Gastgeber neben Kongresspräsident und ebenfalls MINQ-Spezialist PD Dr. med. Jörg Dickschas von der Sozialstiftung Bamberg und Dr. Arno Schmeling vom Sporthopaedicum Berlin zu der Veranstaltung ein.
Als Veranstaltungsort dient das alte, anatomische Institut in der der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Leitung Prof. Dr. Lars Bräuer). Am ersten Tag des Kongresses werden sämtliche Aspekte rund um die Patella beleuchtet – von der Biomechanik und den anatomischen Grundlagen über die konservative Therapie zur Bandplastik und Osteotomie, bis hin zur Knorpelersatztherapie und zur Teilprothese. Am zweiten Tag haben die Besucher Gelegenheit, das Gelernte als zusätzlich wählbare Erweiterung im Rahmen eines Kadaver Workshops zu vertiefen und anzuwenden (alle gängigen OP-Techniken am Patellofemoralgelenk - von der MPFL Plastik über die Torsions-Osteotomie und Trochleaplastik bis hin zur Teilprothese).
📅 Wann: 27. - 28. Februar 2025
📍 Wo: Anatomisches Institut der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen, Universitätsstraße 19, 91054 Erlangen
🤕 IchalsPatient
1️⃣ KI-Video: Heidis Rettung - Hautnah mit dem Transplantationsteam unterwegs
Filmstoff ist die Geschichte: Im März 2024 wartete die sechs Monate alte Heidi (Name geändert) in Tübingen auf eine lebensrettende Leber. Eltern und nahe Angehörige konnten ihr einen Teil ihrer Leber nicht spenden. Ihr blieben nur wenige Tage. Dann kam die Nachricht, auf die alle gewartet hatten: Es gibt eine Leber von einem verstorbenen Kind, allerdings in Osteuropa. Um das Organ nach Tübingen zu holen, musste das Tübinger Transplantationsteam eine herausfordernde und nicht alltägliche Reise auf sich nehmen, die beinahe gescheitert wäre. Ohne den Einsatzwillen, den Teamgeist und die Professionalität des Transplantationsteams hätte die Geschichte womöglich kein Happy End gefunden.
Dem Uniklinikum war klar, dass diese Geschichte erzählt werden musste. Aber ein Video drehen? Unmöglich: Verfügbarkeit der Personen, immenser Dreh-Aufwand, Drehs im Flughafen, Rettungswagen oder OP... Warum nicht KI fragen? Das Ergebnis ist sehenswert: „Tübingen – Team Transplant auf lebensrettender Mission“
"Aus je etwa 80 bis 100 Bildern von insgesamt fünf Personen entstand ein professionelles Video. Mithilfe von KI-Tools wie MidJourney, Flux, Sora und Runway wurde die Geschichte in filmischer Qualität nacherzählt – mit realistischen Animationen, atmosphärischen Szenen und flüssigen Übergängen", erklärt Florian Hübner, Geschäftsführer von Startup Creator. Die Umsetzung des Drehbuchs blieb dabei immer in der Hand des Uniklinikums und der Agentur. „Meines Wissens nach gibt es aktuell kein anderes Video, das ausschließlich mit KI eine reale Geschichte mit realen Personen nacherzählt”, betont Hübner.
Auch für den leitenden Transplantationschirurg des Universitätsklinikums Tübingen, Prof. Silvio Nadalin, war die Transplantation besonders: „Seit mehr als 25 Jahren transplantiere ich Lebern und Nieren, auch bei Kindern. Dass im Ausland allerdings kein assistierendes Personal vor Ort ist und wir bis zur letzten Minute auf dem Rollfeld gehofft haben, spontan ein Team zusammen zu bekommen, war auch für mich abenteuerlich. Dass das kleine Mädchen heute lebt und gesund ist, freut mich sehr.“
Eine Langzeitstudie zeigt: Während die Überlebensrate von Säuglingen weltweit zwischen 67 und 79 Prozent liegt, leben ein Jahr nach der OP alle in Tübingen transplantierte Kinder. Nach zehn Jahren sind es 92 Prozent.
Weitere Informationen auf den Seiten der UK Tübingen
MINQ's weekly picks Newsletter
Melden Sie sich kostenlos an, um die neuesten Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten








