
25/2025
Präzisionsmedizin für schmerzende Hände · Medizinische Zeitenwende gefordert · Neue Einsichten in die Genetik unseres Gehirns · Pflanzen unter Hitzestress · Atemrhythmus als individueller Fingerabdruck · Axolotl-Schleim gegen Keime und Krebszellen
📌 5 weekly picks
1 📌 Technik, die zuhört: Präzisionsmedizin für schmerzende Hände
Können Roboter auch besser diagnostizieren? Am Uniklinikum Düsseldorf untersucht ein KI-gestützter Ultraschall-Roboter die Gelenke seiner Patient:innen millimetergenau. Er erkennt Veränderungen an Knochen, Gelenkkapseln, Durchblutung und Sehnen – strahlenfrei und standardisiert. Die Hände sind oft erstes Anzeichen rheumatologischer Erkrankungen, erklärt PD Dr. Oliver Sander. Früher wurde häufig geröntgt – heute liefert Ultraschall frühere und genauere Befunde. Das UKD zählt zu den ersten Kliniken in Deutschland mit diesem zertifizierten Gerät.
Über 10.000 Gelenke bei mehr als 500 Personen wurden bereits untersucht – mit über 95 % Zufriedenheit. Der Roboter gleicht absehbare Versorgungslücken durch Fachkräftemangel in der Rheumatologie aus. Er ersetzt keine Ärztinnen oder Ärzte, hilft aber bei standardisierten Erstuntersuchungen. Was er in 20 Minuten leistet, bräuchte manuell über eine Stunde. Großer Vorteil: Vergleichbare Aufnahmen bei Folgeuntersuchungen aus exakt gleichem Winkel.
Eine mögliche Zukunftsvision: der Roboter als Selbstbedienungsterminal in Service-Zentren. Das könnte die Zahl früher Diagnosen deutlich erhöhen und Wartezeiten senken. Oft liegt den Beschwerden keine Entzündung, sondern Verschleiß zugrunde – das zeigt der Roboter klar. Bei eindeutiger Diagnose beginnt das Team direkt mit einer passenden Therapie. Ziel: Entzündungen früh stoppen, Beschwerden beseitigen und dann schonend behandeln. Ein gutes Beispiel, wie Technologie die medizinische Versorgung sinnvoll ergänzt.
Mehr Informationen zum Thema:
- Der Ultraschall-Roboter im Video
- Interview mit PD Dr. Oliver Sander, Leitender Arzt der Klinik für Rheumatologie am UKD
👉 zur Pressemeldung der Uniklinik Düsseldorf
2 📌 Leopoldina fordert medizinische Zeitenwende
Neue Medizin für das Altern: Angesichts einer rapide alternden Bevölkerung (2035: jede dritte Person über 65) warnt die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in einem aktuellen Diskussionspapier vor einer drohenden Multimorbidität und fordert den Paradigmenwechsel hin zur Geromedizin.
Zentrale Forderung: Der Alterungsprozess selbst muss medizinisch adressiert werden – nicht nur seine Folgekrankheiten wie Krebs, Demenz oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ziel ist eine Verlängerung der Gesundheitsspanne statt bloßer Lebensverlängerung. Neue Erkenntnisse aus der Alternsforschung zeigen, dass biologische Mechanismen wie DNA-Schäden, Zellseneszenz und chronische Entzündung altersbedingte Krankheiten auslösen. Diese Prozesse sind zunehmend therapeutisch behandelbar – etwa durch Senotherapeutika oder Reprogrammierung von Zellen.
Zusammenfassend fordert das Gremium:
- Interdisziplinäres Alternsforschungs-Konsortium aufbauen – mit Multi-Omics-Daten und Biobanken.
- Tierversuchsgesetz reformieren, um experimentelle Alternsforschung zu erleichtern.
- Translation beschleunigen – Biologisches Wissen schneller in die Anwendung bringen
- Nationale Biobank und klinische Studien mit altersbiologischen Biomarkern etablieren.
- Geromedizin als Fach etablieren – mit Curricula, Präventionsprogrammen und ärztlicher Weiterbildung.
Nicht zuletzt brauche es eine gesellschaftliche Vision: Eine präventiv agierende Medizin, die Alter nicht als Defizit, sondern als gestaltbaren Prozess versteht – getragen von Forschung, Versorgung und Aufklärung.
📄 Originalquelle (PDF): Konzepte für eine neue Medizin in einer alternden Gesellschaft – Perspektiven für Forschung und medizinische Versorgung
🔗 Leopoldina Diskussionspapier 2025 (DOI)
3 📌 Neue Einsichten in die Genetik unseres Gehirns: Formen sagen mehr als Volumen
Die klassische Hirnforschung misst gern in Volumen: Wie groß ist das Areal? Wie viel Substanz steckt drin? Doch ein Team vom Institute of Neuroscience and Medicine in Jülich, dem Institute of Neurogenomics am Helmholtz Zentrum München und dem Institute of Systems Neuroscience der Heinrich Heine Universität Düsseldorf hat nun eine bislang kaum betrachtete Dimension vermessen: die Form subkortikaler Hirnstrukturen. Die Ergebnisse, erhoben auf Basis von Daten aus der UK Biobank mit rund 20.000 gesunden Teilnehmer:innen, könnten neue Wege zur Früherkennung neurologischer und psychischer Erkrankungen aufzeigen. Statt nur Größe zählte diesmal die Gestalt. Mithilfe des sogenannten Laplace-Beltrami-Spektrums (LBS) beschrieben die Forschenden 22 subkortikale Strukturen, darunter auch das Kleinhirn, nicht nur in ihrer Masse, sondern in ihren geometrischen Eigenheiten – quasi ein Fingerabdruck für jede Region. Die Analyse führte zu 80 genetischen Varianten, die signifikant mit diesen Formen assoziiert sind, insbesondere im Hirnstamm (37 Varianten).
Was das heißt? Einige dieser genetischen Marker waren bereits aus anderen Studien bekannt – etwa im Zusammenhang mit Bluthochdruck, neurodegenerativen Erkrankungen oder psychischen Störungen. Doch die neue Forschung zeigt: Diese Varianten beeinflussen nicht nur, wie groß eine Region ist, sondern auch, wie sie gebaut ist. Und das könnte mehr über Gesundheitsrisiken verraten, als bislang gedacht. „Die Studie erweitert unser Verständnis darüber, wie genetische Faktoren nicht nur die Größe, sondern auch die Form des Gehirns beeinflussen“, erklärt Kaustubh Patil vom Jülicher Institut für Neurowissenschaften und Medizin. „Die Ergebnisse legen nahe, dass die Form von Hirnstrukturen ein wichtiger Indikator für die Anfälligkeit gegenüber bestimmten Gesundheitsrisiken sein könnte. Langfristig könnten sie dazu beitragen, frühzeitige Diagnosemethoden für neurodegenerative und psychische Erkrankungen zu entwickeln.“
Beyond volume: Unraveling the genetics of human brain geometry, by Sabrina A. Primus, Felix Hoffstaedter, Federico Raimondo, Simon B. Eickhoff, Juliane Winkelmann, Konrad Oexle, Kaustubh R. Patil, Science Advances. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40512868/
4 📌 Pflanzen unter Hitzestress – Science Sonderheft beleuchtet neue Forschungsansätze
Die Klimakrise bringt nicht nur Mensch und Tier ins Schwitzen, sondern auch Pflanzen weltweit. Das aktuelle Sonderheft der Fachzeitschrift Science widmet sich vollständig der Frage: Wie gehen Pflanzen mit zunehmender Hitze um? Von molekularen Mechanismen über die Physiologie einzelner Blätter bis hin zu globalen Ökosystemen beleuchten renommierte Forschungsteams die Antwort der Flora auf Hitzeextreme. Pflanzen haben erstaunliche Strategien zur Hitzebewältigung: Zelluläre Schutzmechanismen, Temperatur-Sensorik, strukturelle Anpassungen und sogar Mikrobenpartnerschaften kommen zum Einsatz. Besonders kritisch ist dabei die Photosynthese, die unter Hitze schnell aus dem Gleichgewicht gerät. Neue Ansätze, etwa zur Optimierung der Pflanzenarchitektur oder zur besseren Wasserregulation, könnten hier Abhilfe schaffen. Auch wilde Pflanzenarten mit erhöhter Hitzetoleranz rücken als genetische Ressource in den Fokus.
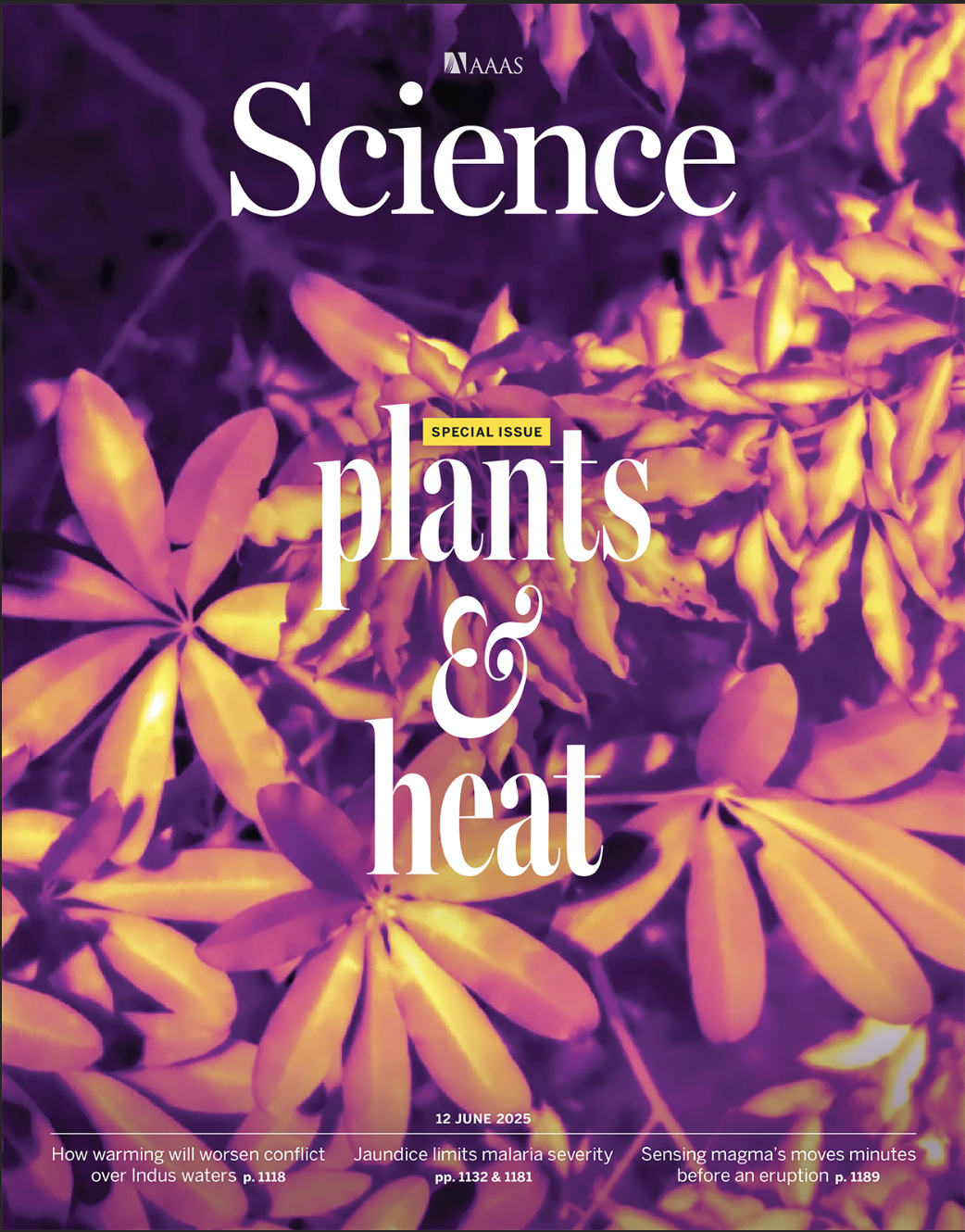
Das Bild ist komplex: Die Reaktion eines einzelnen Blattes lässt sich nicht einfach auf ganze Wälder oder Agrarlandschaften übertragen. Wechselwirkungen mit Boden, Mikroklima und Mikroorganismen machen die Prognose schwer. Gerade Tropenwälder, Prärien und Nutzpflanzen sind bereits heute stark belastet. Das Sonderheft macht klar: Um unsere Ökosysteme und die globale Nahrungsmittelproduktion zu schützen, müssen wir verstehen, wie Pflanzen Hitze begegnen – auf allen Ebenen.
🔗 Zur Inhaltsübersicht: Contents | Science 388, 6752
5 📌 Atemrhythmus als individueller Fingerabdruck
Anscheinend hat jeder Mensch nicht nur einen individuellen Fingerabdruck, sondern auch einen einzigartigen Atemrhythmus. Ein Forschungsteam identifizierte Testpersonen anhand ihrer Atemmuster – mit 96,8 % Genauigkeit. Die Nasenatmung liefert nicht nur Identifikationsmerkmale, sondern auch Gesundheitsinformationen. Atmung wird vom Gehirn gesteuert – und beeinflusst es zugleich. Daraus ergibt sich ein unverwechselbares Atemprofil für jede Person. Forschende entwickelten ein tragbares Gerät zur 24-stündigen Erfassung des Nasenluftstroms. 97 Teilnehmende wurden über zwei Jahre hinweg mehrfach vermessen. Die Daten zeigten deutliche individuelle Unterschiede in Ein- und Ausatmung. Künstliche Intelligenz analysierte 20 Parameter der Atmung. Das System erkannte Atemmuster nach Nasenloch getrennt. Einblicke ergaben sich auch in Verhalten, Hirnaktivität und körperliche Verfassung.
Die Technik könnte in Medizin und Diagnostik Anwendung finden. Atmung verrät mehr über uns, als wir denken – ganz ohne Worte. Ein natürlicher Taktgeber, der uns wie ein innerer Code begleitet. Und ein faszinierender Schlüssel zur personalisierten Gesundheitsforschung.
👉 weiterlesen auf den Seiten von scinexx
🔗 zur Studie: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)00583-4
PLUS …
💬 Über unseren Tellerrand
1️⃣ Hühner gegen Küchenabfall
Hühner als Bioabfall-Manager? Im französischen Colmar verschenkt die Stadt Legehennen an Haushalte, um Küchenabfälle zu reduzieren. Zwei Hühner pro Familie ersetzen dabei die Biotonne – sie fressen Reste und legen Eier.
Das Konzept überzeugt: Die Tiere dienen als „lebendige Kompostiere“ mit Bildungsauftrag. Stall und Erstausstattung werden gestellt – ein Rundum-sorglos-Paket für Einsteiger. Auch in deutschen Städten gibt es “Hühnerprojekte” - etwa Frankfurt und Hanau: In Frankfurt warben Umweltpädagoginnen bereits 2013 für Hühner im Garten – mit dem Hinweis, dass ein Huhn täglich rund 300 Gramm Bioabfall „wegputzen“ kann, während ein Mensch durchschnittlich nur etwa 150 Gramm produziert. Die Stadt Hanau startete 2019 ein Pilotprojekt: sie brachte Legehennen auf das Dach eines städtischen Gebäudes. Die Tiere vertilgten dort nicht nur Essensreste, sondern dienten auch als pädagogisches Projekt, um Kinder und Erwachsene für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu sensibilisieren.
Ein Huhn kann jährlich über 100 kg Bioabfall verwerten – das ist aktiver Umweltschutz. Nebenbei fördern sie die Lebensmittelwertschätzung und liefern täglich frische Eier. Aber nicht alles darf ins Hühnergehege: Zitrusfrüchte, rohe Kartoffeln oder Fleischreste sind tabu. Wer Hühner hält, sollte sich vorab gut informieren – zum Wohl der Tiere. Die Haltung stärkt das Bewusstsein für Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit.
👉 weitere Infos auf den Seiten von Agrarheute
2️⃣ Axolotl-Schleim gegen Keime und Krebszellen
Axolotl können nicht nur Organe regenerieren – ihr Hautschleim enthält antimikrobielle Peptide (AMP). Diese natürlichen Moleküle bekämpfen Krankheitserreger und sind für die Medizin hochinteressant.
Forschende der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) untersuchen AMP als Alternative zu Antibiotika bei resistenten Keimen wie MRSA. Vier identifizierte AMP wirkten sogar besser als das Reserveantibiotikum Vancomycin. Drei dieser Peptide zeigten zudem Wirkung gegen Brustkrebszellen – ohne gesundes Gewebe zu schädigen. Die Peptide wurden durch sanfte Massage der Tiere unter strengen Tierschutzauflagen gewonnen.
Aus tausenden AMP wurden 22 Kandidaten synthetisch hergestellt und analysiert. Ihr Wirkmechanismus: Bindung an Bakterienzellen, Zerstörung der Zellmembran oder Angriff im Inneren. Auch Pilze und Viren könnten durch AMP beeinflussbar sein. Forschungen laufen gemeinsam mit dem Fraunhofer ITEM Hannover. Die Erkenntnisse sind ein vielversprechender Ansatz im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen. Zugleich leisten die Tiere durch Nachzuchtprojekte wie das ABMC einen Beitrag zum Artenschutz. Das Zentrum beherbergt mehrere bedrohte Lurcharten und arbeitet international vernetzt. AMP gelten als schwer herstellbar – ihr Potenzial ist dafür umso größer. Die Forschenden betonen: Weitere Studien sind nötig, doch das therapeutische Potenzial ist enorm.

👉 weiterlesen auf den Seiten der MHH
📬 In unserer Mailbox
🥦 BfR-Podcast zur pflanzenbasierten Ernährung und der COPLANT-Studie
Immer mehr Menschen in Deutschland verzichten auf Fleisch und tierische Produkte – aus ethischen, ökologischen oder gesundheitlichen Gründen. Laut Professorin Cornelia Weikert vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kann eine pflanzenbasierte Ernährung durchaus gesund sein, wenn sie ausgewogen gestaltet wird. Wer sich jedoch ausschließlich oder überwiegend pflanzlich ernährt, muss besonders auf die ausreichende Versorgung mit Nährstoffen wie Vitamin B12, Jod und anderen Spurenelementen achten. Insbesondere Veganer:innen wiesen laut BfR-Studien häufig einen Jodmangel und eine geringere Knochendichte auf – bei Vitamin B12 hingegen waren sie meist gut versorgt. Vegetarier:innen hingegen sind häufiger von einem B12-Mangel betroffen.
Besonders sensible Gruppen wie Kinder, Schwangere oder ältere Menschen sollten ihre Ernährung sorgfältig planen. Zwar gibt es Hinweise darauf, dass eine ausgewogene vegane oder vegetarische Ernährung Krankheiten wie Adipositas, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen kann, jedoch fehlen belastbare Langzeitdaten – vor allem im Hinblick auf moderne Ersatzprodukte aus dem Supermarkt. Hier setzt die COPLANT-Studie an: In dieser großangelegten Bevölkerungsstudie untersucht das BfR mit rund 6.000 Teilnehmenden, wie sich verschiedene Ernährungsformen – vegan, vegetarisch, pescetarisch und Mischkost – auf die Gesundheit auswirken. Gesammelt werden Daten zu Ernährung, Lebensstil und Gesundheitsparametern. Interessierte können sich auf www.coplant-studie.de zur Teilnahme anmelden.
Zum Podcast:

📣 Ankündigungen
1️⃣ Diagnostik und Intervention – Austausch und Innovationen beim Münchner Neuroradiologie-Symposium
Unter der Wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. med. Thomas Liebig (MINQ-Spezialist), PD Dr. med. Robert Forbrig und Dr. med. Klaus Seelos vom Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie der LMU/ Campus Großhadern startet am 23. Juni das Münchner Neuroradiologie-Symposium. Die Tagung dient als Plattform für fachlichen Austausch, aktuelle Entwicklungen und innovative Konzepte in der Neuroradiologie. Geplant sind Expertenvorträge, interaktive Sessions und praxisorientierte Workshops. In der angenehmen Atmosphäre des Kardinal Wendel Hauses in Schwabing erwartet man sich neue Impulse für das Fachgebiet.
📅 Wann: 23. bis 25. Juni 2025
📍 Wo: Kardinal Wendel Haus, Mandlstr. 23, 80802 München
2️⃣ Altern und Atemwege – Herausforderungen für die Pneumologie
Der demographische Wandel stellt die Medizin vor neue Herausforderungen, besonders in der Pneumologie. Das 56. Bad Reichenhaller Kolloquium widmet sich diesem Thema unter dem Motto „Die Lunge im Alter“.
Wann handelt es sich bei Symptomen um eine Erkrankung, und wann um normales Altern? Von der komplexen Differenzialdiagnose bis zu innovativen Therapieansätzen werden verschiedene Perspektiven beleuchtet. Auch die intensivmedizinische Versorgung älterer Patient:innen steht im Fokus.
Erfahrene Experten präsentieren das „Clinical Year in Review“ und leiten interaktive Diskussionen. Ein ILD-Board ermöglicht vertiefte Fallanalysen und praxisnahen Austausch. Die Workshops bieten praxisorientierte Einblicke in die flexible Bronchoskopie und thorakale Bildgebung.
📅 Wann: 27. und 28. Juni 2025
📍 Wo: Magazin3, Alte Saline 15, 83435 Bad Reichenhall
🤕 IchalsPatient
1️⃣ Signal für Gerechtigkeit: Eingriff aus 7.000 Kilometern Entfernung
In Afrika ist erstmals ein Krebspatient (Prostata-Karzinom) erfolgreich robotergestützt aus der Ferne operiert worden – von einem Chirurgen, der sich 11.000 Kilometer entfernt in den USA befand. Der Patient befand sich in Luanda, der Hauptstadt Angolas. Der 67-jähriger Patient wurde am vergangenen Samstag operiert und konnte das Krankenhaus bereits drei Tage später wieder verlassen.
Vor Ort arbeitete ein medizinisches Team aus Chirurg:innen, Anästhesist:innen, Pflegepersonal und einem Mitglied des US-amerikanischen OP-Teams. Der leitende Chirurg selbst steuerte den Eingriff aus einem Krankenhaus in Florida – eine Premiere auf dieser Distanz.
Prostatakrebs zählt zu den häufigsten Todesursachen bei Männern südlich der Sahara. Die begrenzten Ressourcen für Früherkennung und spezialisierte Eingriffe erschweren eine wirksame Versorgung. Der leitende Arzt betonte die Bedeutung des Projekts: „Diese Operation markiert nicht nur einen technologischen Meilenstein, sondern auch einen wichtigen Schritt hin zu mehr globaler Gesundheitsgerechtigkeit.“
👉 Mehr dazu im Deutschlandfunk

MINQ's weekly picks Newsletter
Melden Sie sich kostenlos an, um die neuesten Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten










